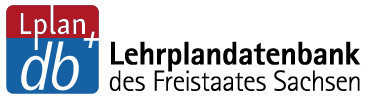Arbeitsprozesse in gewerblich-technischen Berufsfeldern bestimmen sich aus der technologischen Ablaufstruktur in betrieblichen Geschäftsprozessen. Arbeitsprozesse sind z. B. das Herstellen, das Montieren oder Installieren, die Inbetriebnahme, das Betreiben (Produktnutzung) und das Instand halten (Warten, Inspizieren, Instand setzen).
Achtung: Sie verwenden noch den veralteten Internet Explorer! Bitte wechseln Sie für eine
korrekte Darstellung des Schulportals auf einen modernen Browser wie den Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
Wenn Sie bereits Microsoft Edge installiert haben, können Sie hier per Klick direkt wechseln!