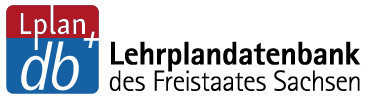Das Fach Orientierung/Mobilität leistet einen eigenständigen und unverzichtbaren Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe und dem selbstbestimmten Leben sehgeschädigter Schüler.
Das Fach richtet sich an alle Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Sehen, die auf Grund ihrer spezifischen Sehschädigung (Sehbehinderung oder Blindheit) bzw. ihrer visuellen Wahrnehmungsstörung auf den Erwerb sehgeschädigtenspezifischer Kompetenzen angewiesen sind.
Blinde Schüler können nicht mehr oder nur in sehr geringem Maße auf der Grundlage visueller Eindrücke lernen. Für diese Schüler schafft das Fach die Möglichkeit, alle Sinne durch geeignete Lernangebote zu sensibilisieren und entsprechend der Situation kompensatorisch nutzen zu können. Für eine sichere Orientierung und Mobilität erwerben die Schüler geeignete Techniken und Strategien.
Für Schüler mit einer Sehbehinderung zielt das Fach auf die optimale Nutzung des vorhandenen Sehvermögens. Diesbezüglich lernen die Schüler ausgewählte Techniken und Strategien unter Verwendung ihrer individuellen Hilfsmittel kennen und situationsgerecht anzuwenden.
Im Zentrum des Faches Orientierung/Mobilität stehen für alle sehgeschädigeten Schüler der Erwerb von Wissen, die Entwicklung von Kompetenzen und die Orientierung auf Werte. Diese versetzen die Schüler in die Lage, sich unabhängig, ungefährdet und zielgerichtet in ihrer Lebenswelt zu orientieren, zu bewegen und möglichst selbstständig am Lernen und Leben in der Schule teilnehmen zu können.
Gleichzeitig bietet das Fach den Rahmen, eigene Möglichkeiten und Grenzen im Umgang mit der Behinderung zu erfahren und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum persönlichen Behinderungsmanagement.