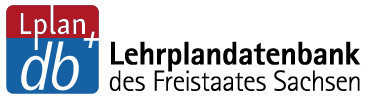Der Lehrplan ist gegliedert in einen grundlegenden und einen speziellen Teil. Der erste Teil stellt schulpolitische und schulpädagogische Grundlagen der Integration sowie didaktische Prinzipien des Unterrichts von Deutsch als Zweitsprache dar, auf denen die Angaben zur Planung und Durchführung des Unterrichts im speziellen Teil beruhen. Der spezielle Teil folgt im Aufbau der sächsischen Konzeption zur Integration von Migranten. Er ist nach dem Grad der Beherrschung des Deutschen in drei Etappen gegliedert und modular aufgebaut.
Achtung: Sie verwenden noch den veralteten Internet Explorer! Bitte wechseln Sie für eine
korrekte Darstellung des Schulportals auf einen modernen Browser wie den Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
Wenn Sie bereits Microsoft Edge installiert haben, können Sie hier per Klick direkt wechseln!