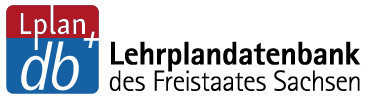Achtung: Sie verwenden noch den veralteten Internet Explorer! Bitte wechseln Sie für eine
korrekte Darstellung des Schulportals auf einen modernen Browser wie den Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
Wenn Sie bereits Microsoft Edge installiert haben, können Sie hier per Klick direkt wechseln!