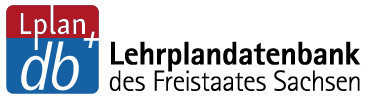Durch die Beschäftigung mit der Sprache und Kultur des antiken Griechenlands lernen die Schüler die Anfänge von Literatur, bildender Kunst und Wissenschaft in Europa kennen. Daher ist für den fächerverbindenden Grundkurs Graecum und antike Kultur das Erlebnis von Ursprungsprozessen, die die europäische Kultur bis heute nachhaltig prägen, besonders charakteristisch.
Der fächerverbindende Grundkurs Graecum und antike Kultur ist in folgenden Bereichen der europäischen Kultur von Bedeutung:
- Literatur und Mythologie
- Philosophie und Ethik
- Politik und Gesellschaft
- Architektur und bildende Kunst
- Religion und Christentum
Im fächerverbindenden Grundkurs Graecum und antike Kultur werden sprachliche, kulturelle und soziale Kompetenzen gefördert. Die sprachliche Auseinandersetzung mit der Differenziertheit des Griechischen entwickelt muttersprachliche Kompetenz weiter und vertieft bewusste Sprachreflexion sowie die Fähigkeit zum Umgang mit geistes- und naturwissenschaftlicher Terminologie.
Der systematische Erwerb von soliden lexikalischen und grammatischen Kenntnissen sowie von Kompetenzen zur Analyse und Synthese sprachlicher Strukturen ist grundlegend für ein hermeneutisch gesichertes Verstehen sprachlicher Äußerungen und die Basis für eine intensive, exemplarische Auseinandersetzung mit den Textinhalten.
In der griechischen Literatur und Kultur liegen entscheidende Wurzeln für das politische und soziale Bewusstsein Europas. Durch die kritische Auseinandersetzung mit ihnen erhalten die Schüler vielfältige Anregungen, ihr Leben verantwortungsvoll zu gestalten und aktiv in Staat und Gesellschaft mitzuwirken. Der fächerverbindende Grundkurs Graecum und antike Kultur entwickelt das Wertebewusstsein und die Verantwortungsbereitschaft der Schüler weiter.
Durch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Sachverhalten fördert der fächerverbindende Grundkurs Graecum und antike Kultur das Interesse der Schüler für Politik und schafft bei ihnen ein Bewusstsein für lokale, regionale und globale Herausforderungen ihrer Zeit.
In den griechischen Texten begegnen den Schülern Grundfragen menschlicher Existenz, denen sie sich vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lebenssituation stellen. Diese bieten Denkmodelle, die der exemplarischen Problemdarstellung und -erörterung dienen. Durch die intensive Beschäftigung mit diesen Denkmodellen werden die Schüler dazu angeregt, kritisch über die Lösung gegenwärtiger Probleme zu diskutieren und Alternativen zu aktuellen Lebens- und Denkgewohnheiten zu durchdenken. Sie entwickeln vielfältige Problemlösestrategien sowie eine interkulturelle kommunikative und kreative Handlungsfähigkeit.
Insgesamt stellt der fächerverbindende Grundkurs Graecum und antike Kultur einen ganzheitlichen Sprach- und Kulturunterricht dar, der gekennzeichnet ist durch seinen ausgeprägten Gegenwartsbezug mit seiner europäisch ausgerichteten Dimension.