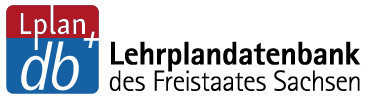Latein als Basissprache Europas stellt in Texten aus einer Überlieferungstradition von mehr als zweitausend Jahren Gegenstände aus allen wesentlichen Bereichen menschlichen Kulturschaffens zur Verfügung. Beispielhafte Texte eröffnen nicht nur Zugänge zu wesentlichen Kenntnissen, die für das Verständnis von Sprache und Kultur erforderlich sind, sondern zeigen auch die Spezifika der literarischen Gattungen im Kontext ihrer abendländischen Rezeption.
Der fächerbindende Grundkurs Latinum und antike Kultur beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit folgenden Bereichen der europäischen Kultur:
- Literatur und Mythologie
- Politik und Gesellschaft
- Architektur und bildende Kunst
- Philosophie und Ethik
- Religion und Christentum
Im fächerverbindenden Grundkurs Latinum und antike Kultur werden sprachliche, kulturelle und soziale Kompetenzen gefördert. Die sprachliche Auseinandersetzung mit der Differenziertheit des Lateinischen entwickelt muttersprachliche Kompetenz weiter und vertieft bewusste Sprachreflexion sowie die Fähigkeit zum Umgang mit geistes- und naturwissenschaftlicher Terminologie.
Der systematische Erwerb von soliden lexikalischen und grammatischen Kenntnissen sowie von Kompetenzen zur Analyse und Synthese sprachlicher Strukturen ist grundlegend für ein hermeneutisch gesichertes Verstehen sprachlicher Äußerungen und die Basis für eine intensive, exemplarische Auseinandersetzung mit den Textinhalten.
In der kontrastierenden Beschäftigung mit der Antike und der heutigen Lebenswelt werden Kontinuität und Diskontinuität in den Auffassungen menschlichen Denkens und Handelns erfahrbar. Die Schüler erarbeiten sich dabei auch ein Repertoire an Denk- und Handlungsmöglichkeiten für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung und entwickeln Lösungsansätze für gegenwärtige Probleme und drängende Zukunftsfragen.
Die antike Kultur fordert durch ihre Andersartigkeit, die trotz der Kontinuität der abendländischen Tradition aufgrund der zeitlichen und räumlichen Distanz zur heutigen Kultur besteht, zur aktiven Auseinandersetzung heraus und fördert die Fähigkeit zur Akzeptanz des gegenwärtig Fremden. Die notwendige Positionierung der Schüler zu den Vorstellungen der Antike befähigt sie zu (selbst-)kritischer Analyse der Gegenwart und ihrer Ideologien und leistet so einen Beitrag gegen eine Verabsolutierung des Eigenen. Die Schüler lernen sich selbst als Teil einer Gesellschaft und eines Traditionszusammenhangs zu begreifen und Verantwortung zu übernehmen. Sie entwickeln ihre interkulturelle kommunikative Handlungsfähigkeit weiter.
Die Zieltätigkeiten des fächerbindenden Grundkurses Latinum und antike Kultur ermöglichen vielfältig transferierbare systematische Problemlösestrategien im Umgang mit sprachlichen und inhaltlichen Phänomenen und fördern Kreativität.
Insgesamt stellt der fächerbindende Grundkurs Latinum und antike Kultur einen ganzheitlichen Sprach- und Kulturunterricht dar.