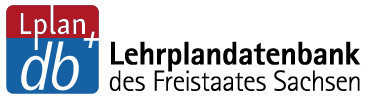Der Lehrplan gilt in der Berufsschule für den berufsübergreifenden Bereich der dualen Berufsausbildung, für das Berufsgrundbildungsjahr sowie für den berufsübergreifenden Bereich in der Berufsfachschule. (Im Rahmen der dualen Berufsausbildung kann der Lehrplan Englisch auch für den berufsbezogenen Bereich gelten, sofern in entsprechenden Lernfeldern berufsbezogenes Englisch vorgesehen ist.)
Im Teil Grundlagen enthält der Lehrplan Ziele und Aufgaben der Berufs-schule und der Berufsfachschule sowie verbindliche Aussagen zur Entwicklung von Lernkompetenz. Im fachspezifischen Teil werden für das Fach allgemeine fachliche Ziele ausgewiesen, die in der Regel über den Lernbereichen differenziert beschrieben sind, und dabei die Prozess- und Ergebnisorientierung des schulischen Lernens ausweisen.