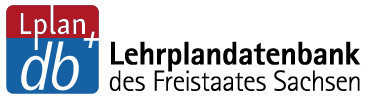Im Teil Grundlagen enthält der Lehrplan Ziele und Aufgaben des Gymnasiums, Aussagen zum fächerverbindenden Unterricht sowie zur Entwicklung von Lernkompetenz.
Im fachspezifischen Teil werden für das Fach die allgemeinen fachlichen Ziele ausgewiesen, die für eine Klassen- bzw. Jahrgangsstufe oder für mehrere Klassen- bzw. Jahrgangsstufen als spezielle fachliche Ziele differenziert beschrieben sind und dabei die Prozess- und Ergebnisorientierung sowie die Progression des schulischen Lernens ausweisen.